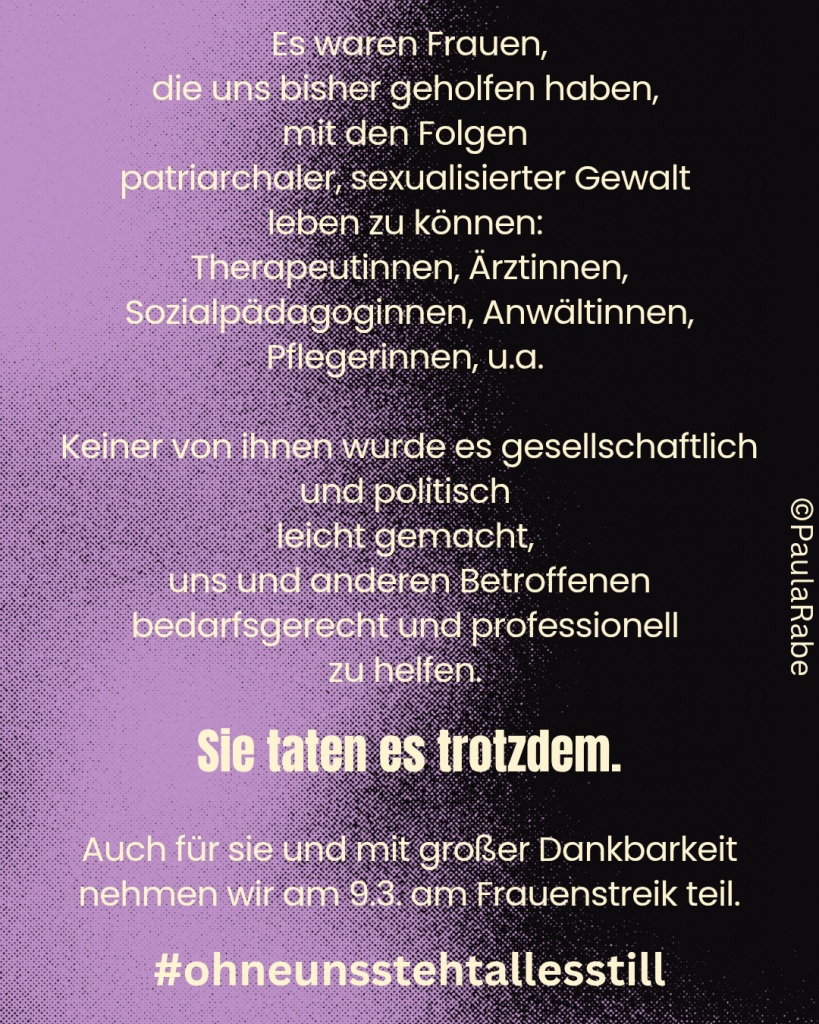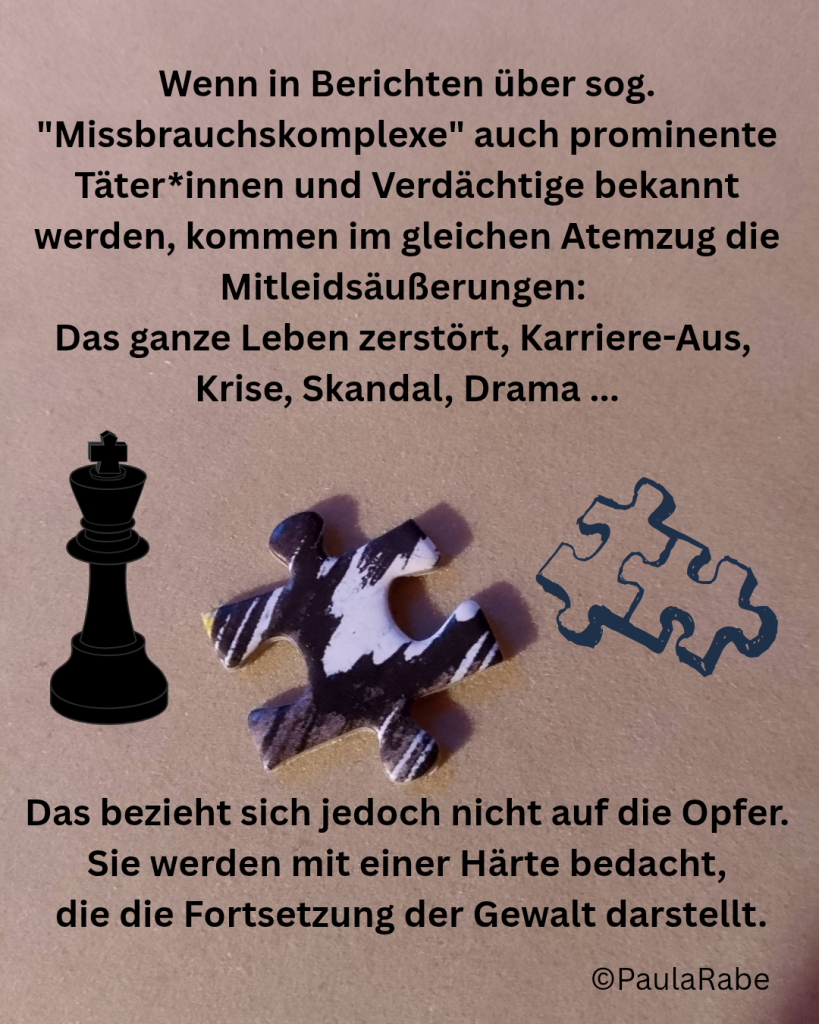Ich sag´s dir jetzt, bevor du fragst,
auch wenn du´s gar nicht hören magst:
Spar dir den Schnick und auch den Schnack,
behalt den Weihnachtsglitzerkack!
Lass mich mit Happiness in Ruh´
und klapp die Märchenbücher zu!
Als Christkind oder Weihnachtsmann
strengst du dich nicht genügend an.
Das Barbieschloss, das Kartenspiel,
der kleine Bär, das Playmobil,
die bunten Stifte und die Bücher,
die hübsch verzierten Taschentücher
-all das hast du vorbeigebracht
und wohl nicht weiter nachgedacht,
was diesem Kind noch widerfährt,
wenn sich das Weinglas schließlich leert
und du schon längst verschwunden bist-
du hast dich viel zu schnell verpisst!
Jetzt sitz ich hier und lebe weiter,
-recht häufig sogar ziemlich heiter-
doch wenn die eine Frage kommt
schwillt mir die Halsschlagader prompt:
Was wünschst du dir denn dieses Jahr,
was fändest du denn wunderbar,
was darf nicht fehlen unterm Baum,
was ist dein Konsumententraum?
Ein Kleid, ein Auto oder Geld,
Geschmeide, das vom Himmel fällt,
ewige Jugend, Schönheit, Stil?
„Zum Glück braucht´s meistens gar nicht viel!“,
das sagen die, die´s eh schon haben
und sich am Leid der and´ren laben.
Ein Wunsch, den ich dir sagen kann,
Christkind oder Weihnachtsmann,
der ist für mich und für die Kleine,
um die ich manchmal ziemlich weine,
die mit den Barbies und dem Schmerz,
dem tiefen Loch im Kinderherz:
Bring uns ´nen Platz für Therapie,
alleine finden wir den scheinbar nie.
Du hast uns ja im Stich gelassen,
da kannst du dich jetzt auch befassen
mit dem, was uns nun unterstützt,
mit dem, was uns im Leben nützt.
Ich hab so viele Mails geschrieben,
die leider ohne Antwort blieben,
hab nachgefragt und angerufen,
nahm hohe Praxiseingangsstufen,
hab uns erklärt und gut beschrieben-
der Erfolg ist leider ausgeblieben.
„Warteliste ist schon voll!“,
„Traumafolgen? Nicht so toll!“,
„Bin kein Profi, hab kein´ Platz!“,
manchmal nur im Nebensatz.
Jetzt hast du meinen Wunsch gehört,
ich hab dich damit wohl gestört,
beim Päckchen packen oder singen,
beim „Glitzer unter Leute bringen“,
bei all den „zauberhaften“ Sachen
hast du ´nen großen Job zu machen!
Für dich gibt´s auch `nen kleinen Dank,
dort hinten auf der Fensterbank,
aus Mürbeteig liegt dort ein Herz
-und eine Karte für den Merz:
Als Kanzler feiert er sich sehr
und dir macht er die Arbeit schwer.
Ich hab´ ihm noch viel mehr zu sagen,
lass dich die Karte zu ihm tragen.
Dann warte ich auf´s neue Jahr
und hoffe weiter-
ist ja klar.